Inhalte und Module des Heidelberger Modells
Auf der Grundlage einer mehr als 40-jährigen praktischen Arbeit mit Familien haben wir ein Weiterbildungskonzept entwickelt, das das gesamte Spektrum der Sozialpädagogischen Familien- und Erziehungshilfe umfasst. In sechs Einzelbausteinen, die inhaltlich aufeinander aufbauen, wird praxisbegleitend eine Zusatzqualifikation in Sozialpädagogischer Familien- und Erziehungshilfe erworben. Bei der Auswahl der Lehrinhalte wird in besonderem Maß auf der Grundlage des systemischen Ansatzes gearbeitet und die unmittelbare Umsetzbarkeit in die Praxis berücksichtigt.
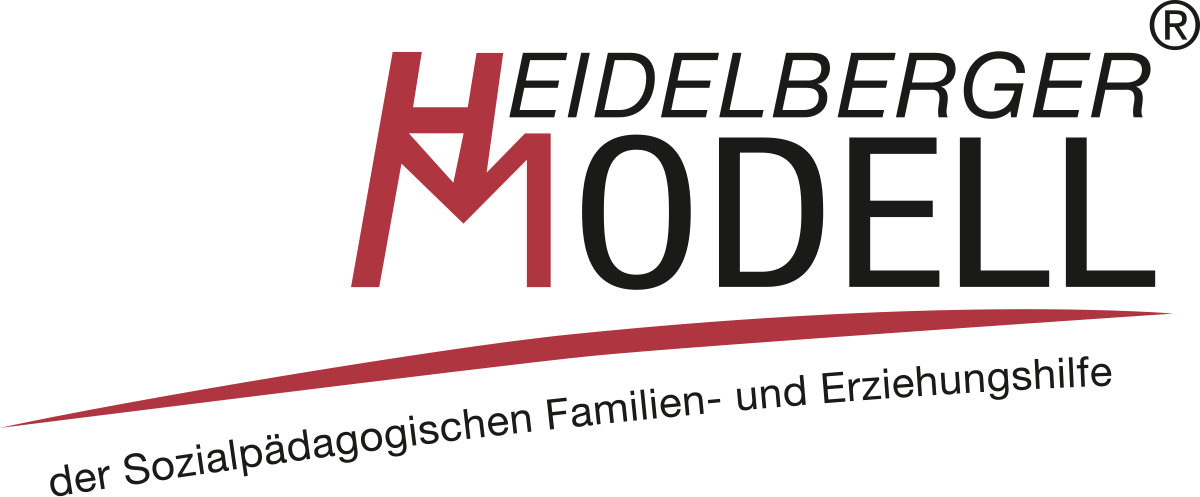
Grundlagen der Sozialpädagogischen Familien- und Erziehungshilfe
Systemische Therapie und Positive Psychotherapie; Leitgedanken; der systemische Blick auf Familien, Kompetenzen der pädagogischen Fachkraft, Integration statt Isolation.
Das Angebot/die Maßnahme
- Sozialpädagogische Familienhilfe von A bis Z
Die Grundorientierung des Heidelberger Modells
- Grundsätze und Leitgedanken
- Positive Psychotherapie und systemische Therapie
- Der systemische Blick auf Familien: Familiensysteme, Rollenverteilungen und Geschwisterbeziehungen
Die Person des Familienhelfers
- Eigenmotivation und soziale Kompetenz
- Klärung des beruflichen Rollenverständnisses, des Arbeitsauftrages und der Rahmenbedingungen
- Grund- und Aktualfähigkeiten
- Balance zwischen Nähe und Distanz
Das umfeldorientierte Modell
- Lebensweltorientierung und Beteiligung
- Ressourcen und Fähigkeitsorientierung
- Integration statt Isolation von A bis Z
Der Methodenkoffer des Heidelberger Modells
Selbsthilfeplan, Familienlageplan (Familienbrett), Energieverteilung, Video-Home-Training, Gesprächsführung; Angst und Depression bei Kindern, Kinder psychisch kranker Eltern, traumatisierte Menschen in der Sozialpädagogischen Familienhilfe.
Mittel und Methoden
- Der Familienlageplan
- Das Soziogramm
- Energieverteilung
- Angst bei Kindern
- Depression bei Kindern
- Kinder psychisch kranker Eltern
Berichte und Reflexionsinstrumente
- Selbsthilfepläne, Handlungsschritte
- Individueller Aufforderungscharakter
Gesprächsführung
- Sensibilisierung des eigenen Gesprächsverhaltens
Spiele und Ziele:
die bisher erarbeiteten theoretischen Kenntnisse werden interaktiv in konkrete Erfahrungen verwandelt. Viele Methoden werden spielerisch eingeübt, Momente der Selbsterfahrung können nicht ausgeschlossen werden.
Spiele und Ziele
- Möglichkeiten des kreativen Einsatzes
- Erkunden und Erkennen von Zielen, Wünschen und Stärken der Familie
- Schwerpunkte des Familienhelfers definieren
- Familieninteraktionen
- Angstbewältigung
- Spielerische Möglichkeit der Vorbereitung des Genogramms /des Familienlageplans
- Ressourcenplanung
- in der Familie
- im Umfeld
- Entspannung
- Brett- und Gruppenspiele als Einsatz in der SPFH
- Kreatives Erstellen des Selbsthilfeplanes
- Übungen zur Entscheidungshilfe
- Zeitlinienarbeit
- Positive Erziehung
Von der Auftragsklärung bis zur Beendigung einer Hilfe.
Systemische Haltungen, Techniken und Fallverständnis. Betrachtung von Schlüsselprozessen in Hilfeverläufen als Garant von Qualität.
Qualitätsentwicklung
- Schlüsselprozesse im Hilfeverlauf
- Erstkontakt
- Arbeitsfeldanalyse und Auftragsklärung
- Beendigung einer Hilfe
- Qualität des Angebots
Grundlagen systemischer Beratung / Therapie
- systemische Fragetechniken
- Hypothesenbildung
- Zirkularität
- Kontextgebundenheit
- Lösungs- und Ressourcenorientierung
- Autopoiese, Nichttrivialität
- Bedeutung von Symptomen
- Neutralität und Allparteilichkeit
- Konstruktivismus: Was ist eigentlich ein Problem?
- Problem oder Krise?
- Fallsupervision
Familienorientierte Schülerhilfe (bei Bedarf)
- Wirksame Hilfesettings und Rahmenbedingungen
- Familienorientierung
Handlungskonzepte für spezifische Situationen
in der Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen. Dynamiken in Suchtkontexten, Vernachlässigung und sexualisierte Gewalt
Gewalt in Familien
- Formen und Auswirkungen von Gewalt
- Erklärungsansätze
Suchtgefahren und Umgang mit Abhängigkeiten
- Definition von Abhängigkeit, Fakten
- Sucht aus systemischer Sicht
- Jugendliche mit Drogen-, Alkoholproblemen
- Dynamik in Suchtfamilien
Vernachlässigung des Kindeswohls
- KJHG § 8 a
- Formen und Auswirkungen
- Einschätzungen und professioneller Umgang
- Verantwortung der Fachkräfte
- Mehrgenerationenperspektive
Sexuelle Gewalt in Familien
- Definition, Formen, Folgen für das Opfer
- Geheimhaltung, Abhängigkeit
- Umgang mit Verdacht und Aufdeckung
- Blick auf die Täter
Interventionsformen und Umgang mit Helfersystemen
Rechtsgrundlagen SGB II und SGB VIII
Familienrecht
- Elterliche Sorge
- Trennung und Scheidung
- Beistandschaft
- Amtsvormundschaft / Amtspflegschaft
Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Träger der Jugendhilfe
- Aufgabenstruktur
- Geltungsbereich
- Hilfen zur Erziehung
- Sonstige Individualhilfen
- Schutz von Sozialdaten
Sozialhilferecht
- Hartz IV
Sonstige Rechtsgebiete
- Betreuungsrecht
- Schweigepflicht
- Zeugnisverweigerungsrecht
- Datenschutz
- Schuldnerberatung
Neben den Bausteinen, der Hausarbeit und dem Kolloquium ist die Peer Group Arbeit ein weiterer integraler Bestandteil der Weiterbildung nach dem Heidelberger Modell.
Zielsetzung:
- Vertiefung der theoretischen Inhalte
- Einüben der Methoden
- Herstellen des Praxisbezuges
Mögliche Inhalte:
- Fallberatung
- Literaturarbeit
Umfang und Rahmen:
Mindestens vier Treffen. Gesamtumfang 20 Zeitstunden.
Empfohlen wird jeweils ein Treffen zwischen den Bausteinen à vier Stunden.
Die Gruppenbildung erfolgt im Verlauf von Modul I.
Nachweis:
Zum Nachweis der Peer Group Arbeit wird Ihnen zu Beginn des Kurses ein Formular bereitgestellt, welches die folgenden Punkte enthält:
- Teilnahme mit Datum und Dauer
- Inhaltliche Dokumentation
- Reflexion des persönlichen Lerngewinns
